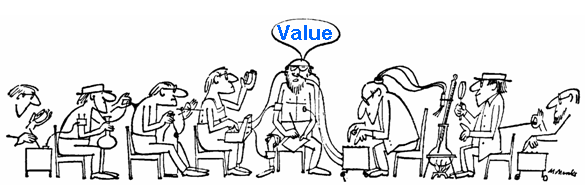Die verwendete Theorie (eine virtuelle Realität) bestimmt, welchen Teil der realen Realität wir erkennen und „wissenschaftlich“ logisch darstellen und artikulieren können.
Keinem Entwickler von Computerchips käme es in den Sinn, auf 100-jährigen Theorien für den Elektromotorenbau aufzubauen. Sonst würde logischerweise wieder ein Elektromotor herauskommen.
Etwa auf dieser Ebene bewegen wir uns, wenn wir zur Erklärung unserer Realen Wirtschaft über 100-jährige wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse heranziehen. Auch wenn sie in der Zeit der physischen Produkte noch so wertvoll für das Verständnis der Wirtschaft waren. Es gilt, so unangenehm das für die klassischen Lehrenkonstrukteure ist, ganz einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass viele der alten Theorien nicht mehr für die Erklärung und Gestaltung der modernen Wirtschaft genügen.
Die Probleme, die durch überholte Theorien in der Praxis verursacht werden, werden zunehmend ersichtlich. Theorie- und Gesetzesmacher verzetteln sich im Dickicht von zunehmenden Regulativen und erklären ihre Unfähigkeit mit der „zunehmenden“ Komplexität von Wirtschaft und Gesellschaft. Verkehrt statt lätz – wie der Appenzeller sagt. Komplex ist nicht die Realität. Komplex ist die Theorie. Komplex ist die Theorie geworden, weil man in deren Grundlagen den Menschen mit seinen subjektiven Bewertungskriterien vernachlässigt hat.
Seit rund 20 Jahren beginnt man den Produktionsfaktor „Know-How“ in die Wirtschaftsmodelle zu integrieren. Und man spricht von der „Wissensgesellschaft“. Wissen als prägendes Element der modernen Wirtschaft. Wissen wird strukturiert und kategorisiert. „Hab‘ nun die Teile in der Hand. Fehlt leider nur das geist’ge Band.“
„Pisa“ lässt grüssen.
Darum nochmals: Der „Wissensansatz“ greift wieder zu kurz. Wissen allein kann – aber muss nicht – nützlich sein. „Können“ ist das Stichwort und Können entwickelt sich erst in der praktizierten Realität.