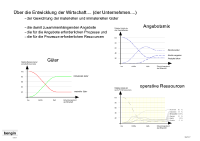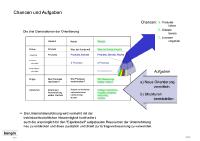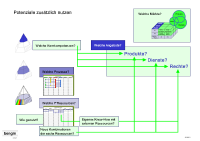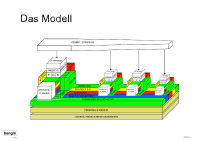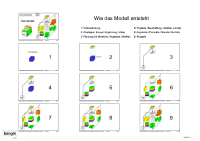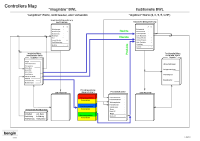|
Vorabversion, in Überarbeitung
Wer wirklich Neues erdenken will, kann nie
verrückt genug sein.
Nils Bor
Vom Low-Tech zum High-Tech zum
No-Tech
Techniken sind
Hilfsmittel, mit denen wir Aufgaben besser lösen können.
Redetechniken, Buchhaltungstechniken.... und andere mehr oder
weniger genormte, bekannte und gelehrte Regeln prägen unser Denken,
Handeln, Entscheiden, Argumentieren und kommunizieren.
Vielfach erleichtern uns neue
Technologien unsere Aufgaben.
Technologien - hier als "physikalische
Techniken" verstanden, sind seit einiger Zeit (speziell mit
der Datenverarbeitung als Querschnittstechnologie) zu einem
zentralen Punkt sowohl der Wertschöpfung als auch der
Wertvernichtung geworden.
Viele Innovationen sind technologiegetrieben und ermöglichten einen
Fortschritt, der noch vor 30 Jahren nicht denkbar erschien. Doch
kommen seit einiger Zeit zunehmend Zweifel, ob denn diese
technologische Entwicklung dem Menschen wirklich von so grossem
Nutzen ist. Oder ob nicht doch auch die Techniken (in breiterem
Verständnis) daraufhin überprüft werden sollen, ob sie denn auch
noch zeitgemäss sind.
Es darf nämlich durchaus in Frage gestellt werden, ob sich
beispielweise 300 jährige Buchhaltungsregeln und 200 jährige
Wertvorstellungen und Metriken heute noch sinnvoll
"flächendeckend" anwenden lassen.
Seit Anfang der 90er Jahre zeichnet
sich zunehmend ab, dass die Wirtschaftswissenschaft mit ihren
klassischen Modellen die heute reale Wirtschaft nicht mehr genügend
erklären kann. Der Fokus im Veränderungsprozess verändert sich
daher von innovativen Technologien zu innovativen Techniken.
Wenn nämlich ein systematischer Fehler in einem mentalen
(geistigen) Modell vorhanden ist, ist er auch in der Software für
einen Rechner vorhanden. Schneller rechnen bringt dann nicht
genauere Resultate. Mit anderen Worten. Das Resultat wird auch mit
Multi-Prozessor-Maschinen nicht besser, wenn die Algorithmen
überholt sind. Oder wenn wesentliche Ressourcen und deren
Eigenschaften nicht oder ungenügend berücksichtigt werden. Wer
erinnert sich nicht mit Schaudern an den Einsturz des
Hallenbaddaches von Uster, weil das Planungsmodell unvollständig
war?
Am Beispiel der Wirtschaftstheorie zeichnet sich immer klarer ab,
dass in den Grundlagen der Lehre (mindestens) zwei systematische
Fehler vorhanden sind, die seit etwa dreissig Jahren verstärkt ihre
Wirkungen zeigen.
(Weitere Erläuterungen auch: E.F.
Schumacher, Rückkehr zum Menschlichen Mass... 1973.)
Fehler a):
Die Lehre kennt keinen Standard, die immaterielle Wertschöpfung
strukturieren und zu quantifizieren.
Dass die doppelte Wertschöpfung gerade der "produzierenden und
dienstleistenden Betriebe" kaum berücksichtigt wird, führt
nicht nur zu Minderauslastungen und entgangenem Gewinn, sondern auch
zu Potenzialabbau.
Fehler b):
In der quantitativen Ökonomie wird die Wertschöpfung auf das
"Messen in linearen" Geldeinheiten "reduziert".
Durch dieses "einfache Modell" wird das gesamte Spektrum
der nichtmonetären Werte - sowohl der Voraussetzungen als auch der
Ergebnisse von Wertschöpfungsprozessen - aus dem quantitativen
Entscheidungsprozess eliminiert.
Die erste gute Nachricht:
Beide Fehler können korrigiert werden.
Die zweite gute Nachricht: Wenn diese Fehler
korrigiert sind, kann der Wertschöpfungsprozess wesentlich
transparenter gestaltet, optimiert und kommuniziert werden.
Diese Darstellungen sind
Teil der Business Engineering Systeme.
Bitte beachten Sie, dass sie (auch geänderte Versionen) ohne Lizenz
nicht für gewerblichen Anwendungen verwendet werden dürfen.
Lizenzen sind die schnellste, sicherste und günstigste Lösung.
Für Lizenz-Anfragen, und auch für andere Formate - um sie mit
wenig Aufwand an Ihre Bedürfnisse anzupassen - wenden Sie sich
direkt an die Adresse unten.
|
Screen Shots aus den
Entwicklungssystemen |
|
Die Darstellungen öffnen sich mit dem
Daraufklicken im gleichen Fenster.
Um wieder auf diese Seite zurück zu kommen
betätigen Sie den "Zurück"-Knopf von Ihrem
Browser.
|
|
Wie sich Schwerpunkte und Orientierung
verschieben |
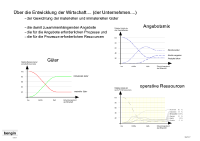
Wie sich die Wirtschaft, deren Angebote und
Voraussetzungen entwickelt hat. Lehre wird dieser Realität
folgen. |
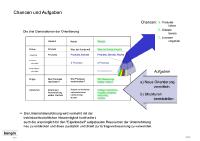
Logische Strategie:
Ressourcen besser nutzen - dazu müssen die Potenziale bekannt
sein. |
|
|
Neue Schwerpunkte für's Controlling |
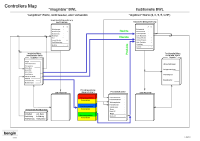
Eine "imaginäre Betriebswirtschaftslehre" für
die immateriellen Voraussetzungen. |

Durch die Entwicklung vom "Low-Tech" zum "High-Tech"
Betrieb verschieben sich schleichend die Kennzahlen. |
|
|
|
|
|